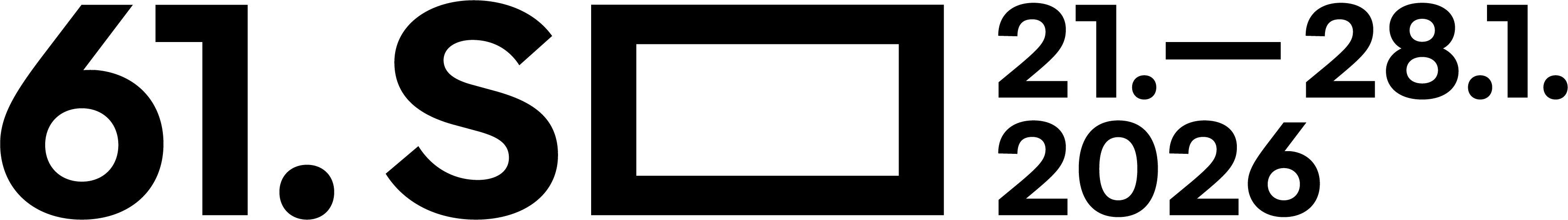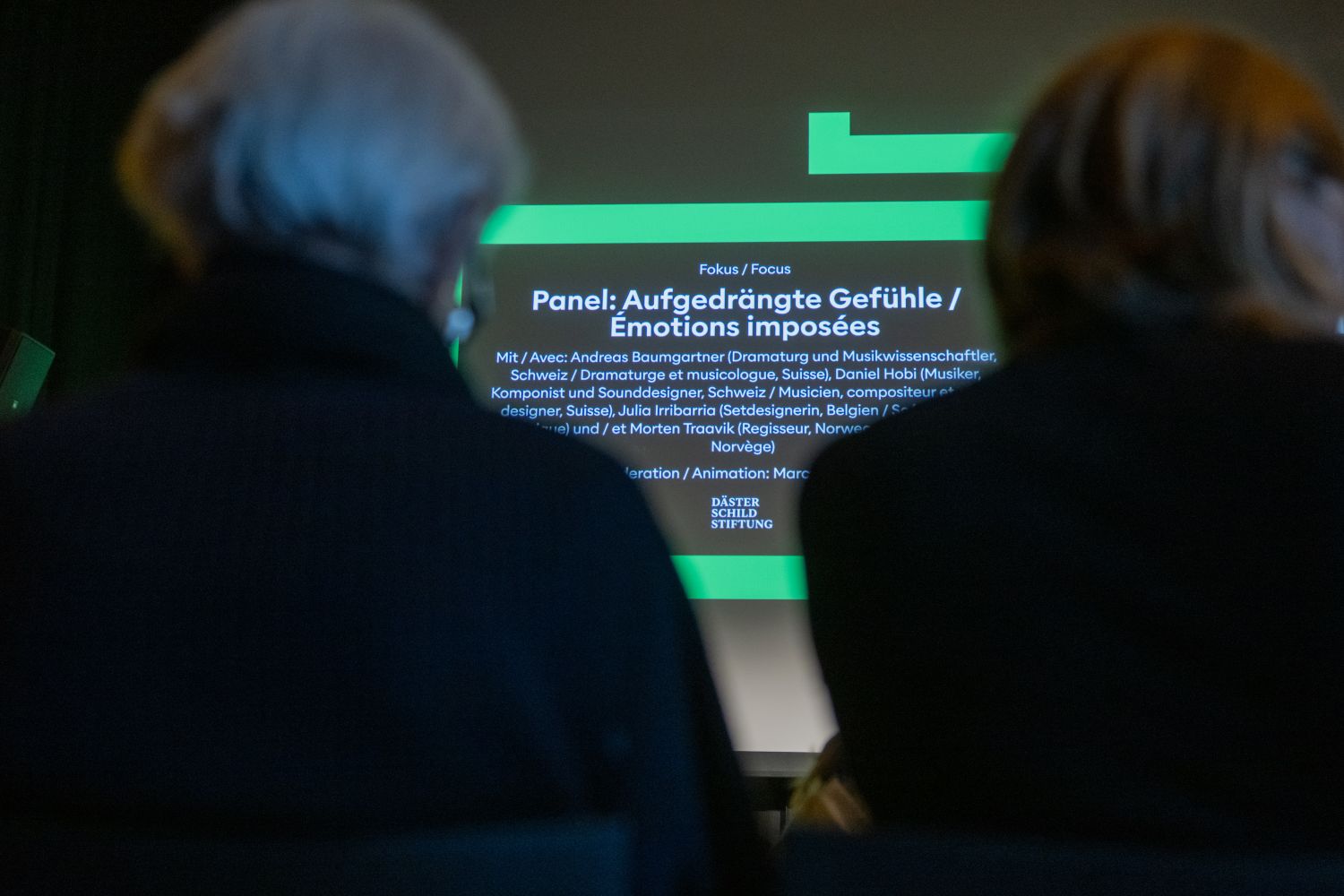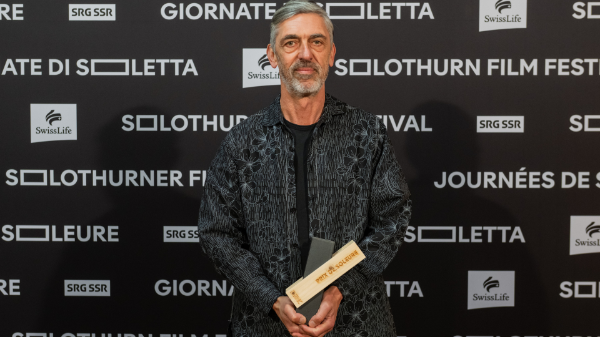Die Sektion «Fokus» der 61. Solothurner Filmtage beschäftigt sich mit Kitsch im Kino. Gezeigt wird eine Auswahl internationaler Spiel- und Dokumentarfilme, die bewusst mit sentimentalen, künstlichen Mitteln spielen oder gesellschaftliche und politische Funktionen von Kitsch thematisieren. Begleitet wird das Filmprogramm von Podiumsdiskussionen und Performances mit Gästen aus dem In- und Ausland.
Kitsch und Kino gehören seit jeher zusammen, im Mainstream- wie im Arthauskino. Autorenfilmer:innen wie Agnès Varda, Pedro Almodóvar oder Chantal Akerman nutzten Kitschelemente, um gesellschaftliche Normen zu hinterfragen oder zu zeigen, wie durch Kitsch bestehende Geschlechter- und Gesellschaftsordnungen verstärkt wurden.
Auch heute ist Kitsch allgegenwärtig. Filmkritiker:innen bemängeln einerseits zu viel Kitsch, während etablierte Kultureinrichtungen mittlerweile die fliessenden Grenzen zwischen Kitsch und Kunst betonen, ob in Klassikern oder in der aktuellen KI-Kunst. Es wird immer schwieriger zu erkennen, wann Kitsch bewusst als kreatives Gestaltungselement eingesetzt und wann er kommerziell ausgenutzt wird. Das hat zuletzt die Diskussion über Nemos Auftritt beim Eurovision Song Contest gezeigt, gilt aber auch für Mainstreamfilme wie «Barbie» oder aktuelle kleinere Produktionen wie die queere Wohlfühl-Trilogie «Oslo Stories». Welche ästhetischen Normen gelten noch? An welche gesellschaftlichen Hierarchien sind sie geknüpft? Und wie gefährlich ist Kitsch in den Händen antidemokratischer Kräfte?
Kitsch zwischen Kunst und Kommerz
Die Sektion «Fokus» der Solothurner Filmtage umfasst zwei Programmteile. In einer Gesprächsreihe tauschen sich Filmschaffende aller Berufsgruppen – von der Regie über die Musik bis zum Set- und Kostümdesign – über ihre eigene Haltung zum Kitsch und ihre Erfahrungen mit Kitsch-Vorwürfen aus. Sie diskutieren mit Kritiker:innen und Expert:innen aus Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Soziologie über die kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung von Kitsch in Zeiten politisch aufgeladener Kulturdebatten, einem wachsenden Verwertungsdruck auf Kultur und den Umgang mit künstlicher Intelligenz, die Kitsch aufgrund von Algorithmen produziert.
Die französische Regisseurin Lucile Hadžihalilović stellt ihren neuen Film «La tour de glace» vor, eine Liebeserklärung an die heilende Kraft des Kinos und die Märchenfilme der 1970er Jahre mit Marion Cotillard in der Titelrolle. Zusammen mit ihrer Setdesignerin Julia Irribarria gibt sie Einblicke in die filmischen Mittel zur Orchestrierung von Gefühlen.
Das Filmprogramm zeigt eine Auswahl internationaler Spiel- und Dokumentarfilme, die sich bewusst unter Kitsch-Verdacht stehender Mittel bedienen oder die gesellschaftliche und politische Wirkung oberflächlicher Sentimentalität thematisieren, wie etwa den Zusammenhang von evangelikalen Kinderpredigern und Rechtspopulismus im brasilianischen Dokumentarfilm «A voz de Deus» von Miguel Antunes Ramos.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Kitsch in der digitalen Filmkultur. Das österreichische Medienkunstkollektiv «Total Refusal» gibt in einer Live-Performance Einblick in die Produktion seiner mehrfach prämierten «Machinimas», auf beliebten Videospielen basierenden Kurzfilmen, mit denen es die Machtverhältnisse unter den künstlichen (kitschigen?) Game-Oberflächen enthüllt.
Programmverantwortung «Fokus»: Julia Zutavern
Hier geht es zum Einleitungstext.
Bilder der 61. Ausgabe
Jährlich präsentieren die Solothurner Filmtage im Spezialprogramm «Fokus» internationale Filme zu einem aktuellen Thema. Am «Fokus-Tag» bieten jeweils Podien und Branchengespräche mit internationalen Gästen die Möglichkeit, das Thema zu diskutieren.
Das Programm «Fokus» wird von der Däster-Schild Stiftung unterstützt.